State of the Climate 2025: Wissenschaft zeigt Pfade für lebenswerte Zukunft
22 von 34 lebenswichtigen „Vitalparametern“ unseres Planeten sind auf Rekordniveau. Viele tendieren weiterhin stark in die falsche Richtung. Das ist die Botschaft der sechsten Ausgabe des jährlichen Klima-Berichts „State of the Climate Report 2025“.
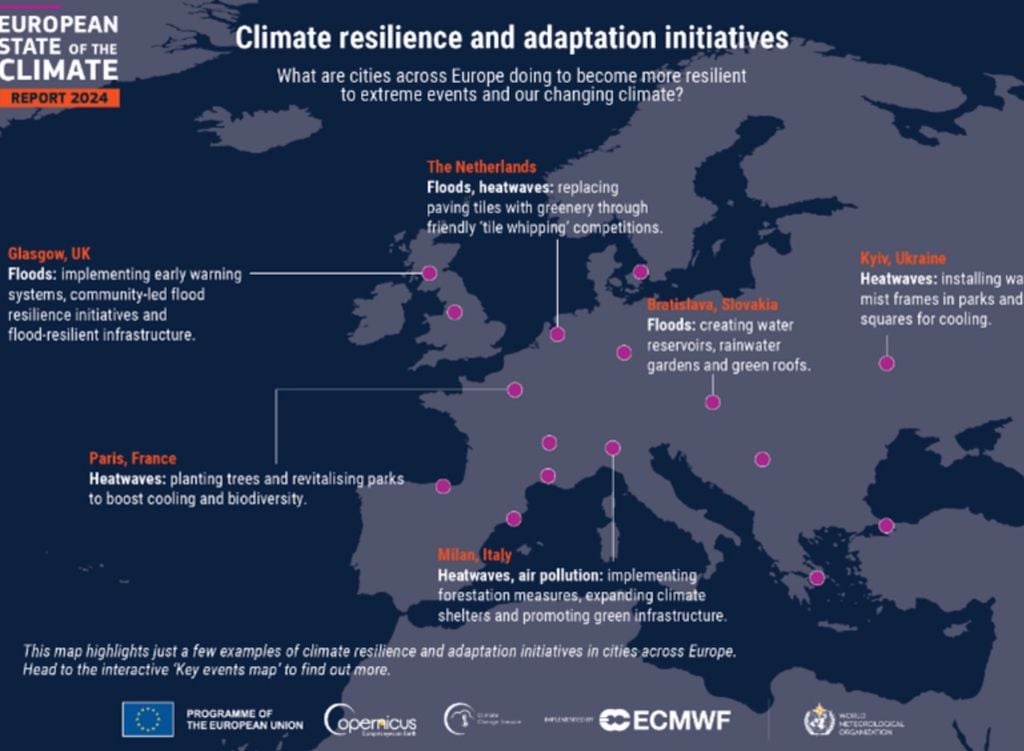
Dieser Zustandsbericht zum Weltklima wurde von einem internationalen Forschungsteam unter Mitwirkung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) erstellt. Leitautoren sind Forschende der Oregon State University. Der Bericht wurde vor wenigen Tagen in BioScience veröffentlicht.
Er stützt sich auf globale Daten des Weltklimarats IPCC. Besonders bemerkenswert sind die enthaltenen Vorschläge für „hochwirksame“ Strategien.
Rekordverdächtige Vitalparameter
Der PIK-Direktor Johan Rockström ist Co-Autor des Berichts. Er äußerte sich wie folgt in einer Pressekonferenz bei dessen Vorstellung:
Die sich beschleunigende Klimakrise berge eine Reihe eng miteinander verbundener Risiken für die grundlegenden Funktionssysteme unseres Planeten – von kritischen Kippelementen wie das Meeresströmungssystem AMOC über die Integrität der Biosphäre bis hin zur Stabilität der globalen Wasserressourcen. Der Bericht zeige aber auch, wie diese beispiellose Bedrohung des Systems Erde – und der Gesellschaft – gemildert werden könne.
2024: das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen
Das Forschungsteam betont die galoppierende Erderwärmung, die sich auch dadurch zeige indem 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war.
sagte William Ripple, Professor an der Oregon State University und einer der Leitautoren bei der Vorstellung der Forschungsarbeit.
Es sei aber festzuhalten, dass sich das Zeitfenster schließe. Ohne wirksame Strategien würde die Menschheit mit rapide steigenden Risiken konfrontiert sein, die den Frieden, die Regierbarkeit, die öffentliche Gesundheit und die Ökosysteme gefährden würden.
Das Forschungsteam hat bei seiner Forschung wirkungsvolle Maßnahmenpakete untersucht und benannt, die Strategien für verschiedene Sektoren beinhalten, darunter Energie, Natur und das globale Ernährungssystem. Dies sei eine Besonderheit der Studie, da auf diese Weise für die genannten Sektoren machbare Optionen genannt werden, die alle einzeln, aber auch zusammen den Treibhausgasausstoß reduzieren und damit die Erderwärmung aufhalten könnten.
Wichtiger Treiber: der Energiesektor
Wenig überraschend haben die Forschenden einen besonderen Fokus auf die erneuerbaren Energiequellen gerichtet. Ihren Analysen zufolge haben Sonne und Wind das Potenzial, bis 2050 bis zu 70 Prozent des weltweiten Strombedarfs zu decken. Begleitet müsse die Energiewende durch einen raschen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, da nur so der notwendige größte Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könne.
Diese Hauptforderung der Wissenschaft wird nicht nur in dieser Studie betont, sondern ist ein zentrale Bestandteil von nahezu allen aktuellen und vergangenen Studien mit dem Ziel einer raschen und umfangreichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
Die Ökosystemen: Säule des Klimaschutzes
In der Studie haben die Forschenden berechnet, dass durch den Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen wie Wäldern, Feuchtgebieten, Mangroven und Mooren bis 2050 jährlich rund 10 Gigatonnen CO₂-Emissionen zurückgeholt oder vermieden werden können. Dies entspricht etwa 25 Prozent der derzeitigen jährlichen Emissionen. Die Rechnung geht natürlich nur darauf, wenn sich die Treibhausgasemissionen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nicht weiter erhöhen, sondern wie gefordert, massiv absinken. Ein weiterer Vorteil wäre der Schutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt sowie der Wasserversorgungssicherheit.
Wenig beachtet - und doch zentral: die Ernährung
Die intensive und extensive Bodenbewirtschaftung hat die Ökosysteme massiv geschädigt. 29 Prozent der Erdkugel entfällt auf die Landoberfläche. Davon sind 71 Prozent bewohnbar. Tatsächlich ist aber nur etwas mehr als ein Prozent der Landfläche bewohnt. 50 Prozent werden für die Landwirtschaft genutzt. 37 Prozent sind Wälder, 11 Prozent sind Buschland und ein weiteres Prozent ist stellt die Oberflächen-Süßwassermenge dar.
Von den 50 Prozent Landwirtschaftsflächen entfallen 77 Prozent direkt und indirekt auf Viehzucht, also auf Fleisch und Milchprodukte, inklusive Weideland und Ackerland für die Tierfutterproduktion. Lediglich 29 Prozent entfallen auf vegetarische Nahrungskomponenten.
Dem Bericht zufolge stellt die Produktion von Lebensmitteln beziehungsweise die Vernichtung von Lebensmittelabfällen etwa 8 bis 10 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen dar. Unter Berücksichtigung der obigen Flächenverteilung ist es nicht verbindlich, dass die Umstellung auf eine pflanzenreichere Ernährung zu einer erheblichen Absenkung der Emissionen führen würde. Der Bericht betont, dass darüber hinaus auch die Gesundheit und die Ernährungssicherheit der Weltbevölkerung durch eine Umstellung der Ernährung und der Landwirtschaft besser abgesichert wären
Warnungen - ganz zum Schluss
Der Bericht betont die bekannten Warnungen der Wissenschaft: Jedes Zehntelgrad zusätzliche Erwärmung wiegt schwer für das Wohlergehen von Mensch und Umwelt. Im Umkehrschluss wirkt jedes Zehntelgrad einer Reduzierung entlastend.
Selbst geringe Verbesserungen haben große Auswirkungen auf das Risiko von Extremhetterereignissen, Biodiversitätsverlust, Nahrungsmittel- und Wasserknappheit sowie die Risiken durch das Überschreiten wichtiger Kipppunkte.
Ein Aufschieben von Maßnahmen führe zu höheren Kosten sowie schwerwiegenderen Auswirkungen, wie das Forschungsteam betonte, während sich schnelle, koordinierte Maßnahmen unmittelbar weltweit für Bevölkerung und Ökosysteme auszahlen.








