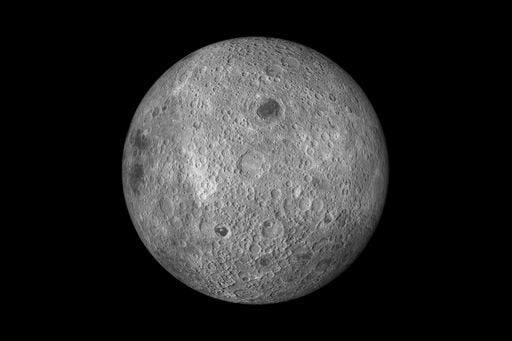Gefahr durch Reifenabrieb: Wie Reifenpartikel unsere Gewässer bedrohen
Durch Wind und Wetter gelangt ein großer Teil des Reifenabriebs in die umliegenden Gewässer und die Natur. Problematisch daran ist nicht allein das Mikroplastik, sondern vor allem die giftigen Substanzen, die dieses freisetzt.

Reifenabrieb klingt erst einmal nach einem eher harmlosen Nebenprodukt des Straßenverkehrs, stellt jedoch eine ernsthafte Umweltgefahr dar: Er macht zwischen 50 und 90 Prozent des Mikroplastiks aus, das bei Regen von Straßen in umliegende Gewässer gespült wird. Eine aktuelle Studie warnt nun eindringlich vor den ökologischen Folgen.
Wissenschaftliche Hochrechnungen zeigen zudem, dass rund 45 Prozent des Mikroplastiks in Böden und Gewässern von Reifen stammen könnten. Die Konzentrationen in aquatischen Systemen schwanken von kaum messbaren 0,00001 bis hin zu alarmierenden 10.000 Milligramm pro Liter.
Hochgiftige Schadstoffe nachgewiesen
Eine aktuelle Übersichtsarbeit im Journal of Environmental Management, an der auch das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) beteiligt war, untersucht nun die Auswirkungen von Reifenabrieb auf Wasserorganismen.
– Prof. Hans-Peter Grossart, IGB-Forscher und Mitautor der Studie
Denn Reifen bestehen aus mehr als Gummi: In ihrer Herstellung werden über 2.400 Chemikalien verwendet, von denen mindestens 144 beim Kontakt mit Wasser (Auslaugung) in die Umwelt gelangen, darunter hochgiftige organische Substanzen wie das besonders kritische 6-PPD und dessen Abbauprodukt 6-PPD-Chinon.
Auch Schwermetalle wie Zink, Mangan, Cadmium und Blei werden freigesetzt. Insgesamt kommen solche Zusätze als Antioxidationsmittel oder Weichmacher, als Ozonschutz oder als Verstärkungs- und Füllmaterialien zum Einsatz.
Dramatische Folgen
Die Stoffe fördern die Bildung freier Radikale, verursachen genetische Schäden und schwächen das Immunsystem. An exponierten Lebewesen konnten Folgen wie beeinträchtigtes Fressverhalten, verringerte Fortpflanzung und eine höhere Sterblichkeit wurden bereits in früheren Studien nachgewiesen werden.
Die Studie zeigt außerdem, dass sich durch den Reifenabrieb die Artenzusammensetzung in Gewässern verändert: Die Biodiversität nimmt ab und Nahrungsnetze werden destabilisiert. Das wiederum beeinflusst zentrale ökologische Kreisläufe, etwa den Kohlenstoff- und Stickstoffhaushalt, und somit Prozesse wie die Biomassebildung und Nährstoffverfügbarkeit.
Allerdings warnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davor, die Laborergebnisse eins zu eins auf natürliche Umgebungen zu übertragen, denn die Bedingungen in der Natur seien wesentlich komplexer.
Diese Faktoren steigerten die Toxizität und veränderten Wechselwirkungen mit mikrobiellen Gemeinschaften, Nährstoffkreisläufen und der Widerstandskraft ganzer Ökosysteme, sagt Grossart.
Ein weiterer Aspekt der Studie sind die Verbreitungswege der Partikel. Zwar können sie durch den Wind weitergetragen werden, doch der Großteil lagert sich in der Nähe ihrer Entstehung ab, etwa in Sedimenten von Straßengräben, Flüssen oder Seen. So fanden Forschende im Tegeler See in Berlin 0,17 Milligramm Reifenabrieb pro Kilogramm Sediment. Im Sediment der Seine in Paris lag der Wert laut einer neueren Studie sogar bei 300 Milligramm pro Kilogramm.
Prävention möglich
Gerade weil die Partikel oft nahe bei ihrer Quelle verbleiben, ist jedoch eine gezielte Vorbeugung möglich.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass Reifenabrieb gravierende Schäden in Gewässern verursachen kann, weswegen er für aquatische Ökosysteme weltweit ein zunehmendes Risiko darstellt.
Quellenhinweis
Song, W., Lin, L., Oh, S., Grossart, H.-P., & Yang, Y. (2025): Tire wear particles in aquatic environments: From biota to ecosystem impacts. Journal of Environmental Management, 388, 126059.
Jaffer, Y. D., Monikh, F. A., Uli, K., & Grossart, H.-P. (2024): Tire wear particles enhance horizontal gene transfer of antibiotic resistance genes in aquatic ecosystems. Environmental Research, 263, 3, 120187.