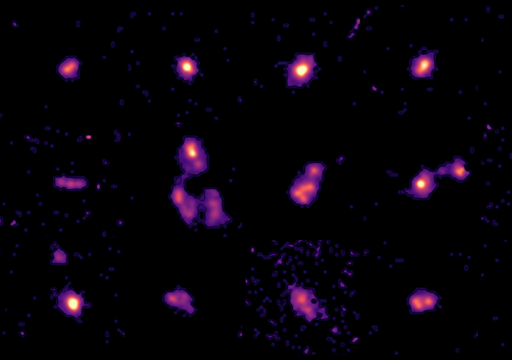Ernährung der Zukunft: Milchalternativen, vegane Burger und Insektenbrot – Proteinrevolution aus dem Indoor-Labor?
Angesichts zunehmender Umweltprobleme, Wetterextreme und Schadstoffbelastung suchen Wissenschaftler nach alternativen Lebensmitteln und Anbauformen. Neben dem Vertical Farming und veganen Burgerpatties wird auch an exotischeren Lösungen geforscht.

Die globale Versorgung mit hochwertigen Nahrungsmitteln gerät immer stärker unter Druck. Wissenschaft und Industrie suchen daher nach nachhaltigen Alternativen, insbesondere für proteinreiche Lebensmittel. Vielversprechend sind etwa alternative Proteinquellen aus Pflanzen, Algen, Insekten und Pilzen.
Im Rahmen des Leitprojekts FutureProteins arbeiten sechs Fraunhofer-Institute gemeinsam an neuen Wegen der Lebensmittelproduktion. Sie entwickeln geschlossene, platzsparende Indoor-Anlagen für eine ganzjährige, standortunabhängige und ressourcenschonende Kultivierung. Dabei setzen sie auf vier zentrale Systeme: Vertical Farming, Insektenzucht, Bioreaktoren für Pilze sowie Photobioreaktoren zur Algenkultivierung.

Die dabei gewonnenen Rohstoffe werden nicht nur einzeln genutzt – zum ersten Mal wurden sie auch systematisch miteinander kombiniert. Das Resultat sind neuartige Prototypen für Lebensmittel, die ernährungsphysiologisch besonders wertvoll sind.
Wie funktioniert Vertical Farming?
Ein zentrales Element der Forschung ist die OrbiPlant-Technologie, ein innovatives Vertical-Farming-System, das von Fraunhofer IME entwickelt wurde. Die Anlage basiert auf einem beweglichen Förderband, das sich wellenförmig auf- und abbewegt. Pflanzen, die darin fixiert sind, wachsen so platzsparend in zwei Richtungen, nämlich auf- und abwärts. Durch die spezielle Konstruktion kann das Licht optimal einfallen, während sich Hitze nicht staut.
– Dr. Marc Stift, Wissenschaftler und Projektkoordinator am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME in Aachen
Ein weiterer Vorteil des Systems ist, dass es ohne Substrat auskommt. Die Pflanzenwurzeln hängen frei im Innenraum des Bandes und werden mittels einer feinen Sprühnebeltechnik, der sogenannten Aeroponik, mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Das reduziert den Wasserverbrauch drastisch im Vergleich zur klassischen Hydroponik. Zusätzlich sind die Pflanzen frei von Erde und Pestiziden, sodass die gesamte Biomasse ohne aufwendige Reinigung weiterverarbeitet werden kann.

Auch die Rückstände aus den Produktionsprozessen werden in einem geschlossenen Kreislaufsystem weiterverwendet. „Ein Beispiel: Kartoffeln werden nach dem Anbau fein zerkleinert, wobei man Stärke und Proteine gewinnt“, erklärt Dr. Stephanie Mittermaier vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV. Übrig bleibe ein wässriges Medium und Kartoffeltrester. „Dieser Kartoffeltrester enthält Ballaststoffe, die im Projekt als hervorragendes Fermentationssubstrat für Pilze identifiziert wurden“, so Mittermaier.
Neue Lebensmittel entwickelt
Die Erkenntnisse aus der Forschung fließen in die Entwicklung marktfähiger Lebensmittelprototypen ein. Am Standort Freising, nahe München, arbeitet ein interdisziplinäres Team an der Optimierung von Geschmack, Geruch, Textur und Nährstoffgehalt der Produkte. Dabei werden auch mehrere Proteinquellen miteinander kombiniert, etwa Erbsen und Pilze.
– Dr. Stephanie Mittermaier vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
Das Ergebnis sollen saftige Burgerpatties mit verbessertem Nährwertprofil sein, die nahezu vollständig auf künstliche Zusatzstoffe verzichten.
Die Bandbreite der entwickelten Produkte reicht von glutenfreien Insektenbroten über pflanzenbasierte Desserts bis hin zu mit Algen gefüllten Teigwaren. „Mit den Burgerpatties aus Erbsen und Pilzen sowie den gefüllten Teigwaren wollen wir den Massenmarkt ansprechen“, erklärt Mittermaier. „Die Insektenbrote sehen wir eher als Nischenprodukt.“
Ziel der Forscherinnen und Forscher ist es, die Neuerungen in die Industrie zu überführen und damit die Lebensmittelproduktion nachhaltig zu verändern. Die neu entwickelten Produkte sowie die neuen Technologien wurden vom 3. bis 8. Mai 2025 auf der internationalen Fachmesse IFFA in Frankfurt präsentiert.